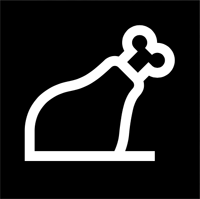Wenn jemandem bei McDonald’s morgen einfiele, dass sich die Idee mit den Burgern so langsam überholt hätte; wenn Pizza Hut ankündigen würde, künftig weniger Teigfladen belegen zu wollen; und wenn Starbucks ein plötzliches Desinteresse an überteuertem Kaffee entwicklen würde – die Welt des schnellen Sofortverzehrs wäre aus ihren Fugen gehoben. Ähnlich wie die Leute, die dafür verantwortlich wären, wenig später aus ihren Jobs.
Clive Schlee hat seinen noch. Seit 2003 schon. Obwohl er im vergangenen Jahr gleich mehrfach öffentlich seine Loyalität zum Brot in Frage gestellt hat. Was für den CEO einer Kette, die ihren Erfolg dem Verkauf von belegten Sandwiches verdankt, einer Ungeheuerlichkeit gleichkommt.
Die Kette heißt Pret A Manger, öffnete ihren ersten Laden vor 31 Jahren in der Londoner Victoria Street und hat frühzeitig den Trend zu besserem Fast Food vorhergesehen: Snacks, die an Ort und Stelle mit frischen Zutaten ohne Geschmacksverstärker zubereitet werden – anstatt einmal aus der Produktion durchs ganze Land gekarrt, um tagelang im Supermarktregal zu vertrocknen, bis sich ein leichtsinniger Sofortesser ihrer erbarmt.
Pret verspricht:
„Freshly prepared, good natural Food“
(Und einen guten Kaffee dazu.) Auf den Verpackungen steht: „made today, gone today“. Das heißt: Alle Snacks werden am selben Tag in einer nahe gelegenen Küche hergestellt. Was nicht am selben Tag verkauft wird, geht an Hilfsorganisationen. Und morgen wieder genau so.
![]()
Die Ausbreitung von Pret A Manger war der Beweis dafür, dass der Markt für Sofortessen nicht zwangsläufig von amerikanischen Franchise-Ketten dominiert werden muss, sondern dass daneben Platz ist für Alternativen. Selbst wenn die einen merkwürdigen französischen Namen haben. Und sich damit auch noch ins Mutterland des Fast Foods trauen, die USA – wo Pret inzwischen auf überschaubare 74 Läden kommt.
![]()
(Weitere gibt’s in Frankreich, Hongkong, China und Dubai.) Seit 2008 gehört das Unternehmen – an dem auch McDonald’s mal beteiligt war – zur Hälfte dem Investor Bridgepoint.
Während sich etablierte Fast-Food-Anbieter mit Konzeptanpassungen oftmals schwer tun, kommt einem die Transformation bei „Pret“ fast mühelos vor. Vielleicht haben die Briten auch bloß Glück, nicht mal dann einen Aufschrei zu provozieren, wenn sie sich langsam aber sicher von ihrem signature snack verabschieden – dem Snack, mit dem sie groß geworden sind.
„Ich mag das Sprichwort: ‚Wenn du der Gleiche bleiben willst, musst du dich ständig verändern“, hat Clive Schlee im vergangenen Jahr in seinem Blog verraten, in dem er sich direkt an die Kunden wendet, um Neues in den Filialen anzukündigen oder sie um Feedback zu bitten. (Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, Leuten auf Twitter zu antworten, die ein misslungenes Sandwich gekauft haben.)
„Vor zehn Jahren waren Sandwiches für fast 30 Prozent unserer Umsätze verantwortlich – 2016 werden es weniger als 10 Prozent sein“,
erklärte der CEO. Und bestätigte in einem Interview mit „Fortune“ kürzlich, in Zukunft noch weniger Snacks zwischen zwei Brotscheiben einklemmen zu wollen: Pret gehe „away from bread-based products“ – weg vom Brot.
Den vollen Regalen sieht man das in vielen Läden zwar noch nicht an.
![]()
Aber den Umsätzen scheint der Wechsel nicht zu schaden. Im Gegenteil: Dieses Frühjahr meldete Pret A Manger eine Umsatzsteigerung um 15 Prozent auf 776 Millionen britische Pfund. Die neuen Snacks in den Regalen sind immer öfter: Joghurts, Suppen, Salate – und seit einem Jahr zunehmend vegetarisch.
Anfang Juni 2016 eröffnete Schlees Team im Londoner Stadtteil Soho den ersten „Veggie Pret“ – eine Filiale, in der es ausschließlich fleischfreie Produkte zu kaufen gibt.
![]()
Der Test war ursprünglich nur auf einen Monat angelegt. Aber schon nach kurzer Zeit war klar, dass die Idee bei vielen Kunden einen Nerv getroffen hatte. Aus einem Monat wurden zwei, dann drei. Schließlich gab Schlee per Blogpost bekannt:
„Veggie Pret is here to stay“
Der ganz in grün getunkte Laden ist seitdem dauerhaft geöffnet. Und wie am ersten Tag: ein Hit. Im April eröffnete eine weitere Pret-A-Manger-Filiale als „Veggie Pret“ neu, diesmal im Stadtteil Shoreditch.
Wenn die deutschen Supermärkte und Sofortessen-Anbieter schlau sind, schauen sie sich ein bisschen was von der Taktik der Briten ab, um neue Kunden zu gewinnen.
1. Schnell experimentieren, schnell lernen
Natürlich kann man als Unternehmen aufwändige Datensammelaktionen starten, um Kunden möglichst viele Details aus ihren Bonuskarten und Smartphones herauszuleiern und die dann monatelang auszuwerten. Oder man schaut sich einfach die Informationen an, die eh schon in den eigenen Kassen schlummern.
Pret A Manger hat sich für die zweite Möglichkeit entschieden und ermittelt, in welchem Stadtteil Londons die Kunden in regulären Pret-Läden am häufigsten fleischfreie Produkte kaufen. Damit war automatisch der Standort für den zweiten Veggie Pret in der Great Eastern Street gefunden, erklärt Schlee – „based on the high levels of vegetarian sales in the area“. Manchmal kann Big Data so einfach sein.
Keine drei Monate später hat Pret den nächsten Test gestartet und vor wenigen Wochen in über 90 britischen Filialen „veggie fridges“ eingeführt: Kühltheken mit grünem Rahmen, in denen ausschließlich vegetarische Snacks zu finden sind, ohne dass Kunden zwischen den übrigen Produkten danach suchen müssen.
(Bislang waren Veggie-Snacks in der Regel nur mit einem kleinen grünen V auf dem Preisschild gekennzeichnet.)
„Wenn ihr das mögt, lassen wir die Theken den Sommer über stehen“, hat Schlee versprochen. Und gleichzeitig erklärt, warum die Initiative auch mit Risiken verbunden ist. Weil niemand abschätzen kann, ob Fleischesser sich von den „veggie fridgges“ abgeschreckt fühlen – und dann womöglich weniger Snacks gekauft werden, die in separate Schränke wegsortiert sind. (Oder halt das genaue Gegenteil passiert.)
Aber selbst wenn die Grühlschränke nicht so erfolgreich sind, wie das Pret-Management hofft, hat die Aktion einen Vorteil: Filialen, in denen die Verkäufe der fleischfreien Snacks stark ansteigen, empfehlen sich direkt als neuer Veggie-Pret-Standort.
Die Pret-A-Manger-Strategie ist simpel, aber effektiv: Tests werden konsequent umgesetzt, auch wenn sie Risiken beinhalten; Ergebnisse werden anschließend schnell ausgewertet, um Schlüsse daraus zu ziehen und sofort den nächsten Test zu starten. Anders als im deutschen Lebensmittelhandel, der mit gastronomischen Angeboten immer erst ganz groß scheitern muss – um dann wieder ganz von vorne anzufangen.
Nicht wahr, „Made by Rewe“–„Oh Angie“–„Deli am Markt“?
2. Clever kommunizieren
Vor allem kommuniziert Pret A Manger offen gegenüber seinen Kunden – ohne die Angst, die Konkurrenz könnte sich was von neuen Initiativen abgucken. (Macht sie ja eh, wenn die erfolgreich sind.) Das trägt entscheidend zur Glaubwürdigkeit bei, die für Pret von Anfang an ein wichtiger Punkt gewesen ist.
Es hilft auch nichts, ein rotes Logo auf grün zu ziehen, weil im Sortiment plötzlich zwei Salate mehr auftauchen – so wie es McDonalds’ vor einigen Jahren in vielen Ländern getan hat, um dem Vorwurf gegenzusteuern, der Burgerriese trage übermäßig zur Verfettung der Gesellschaft bei.
Dass Pret seine Veggie-Filialen komplett in grün tunkt, passt dagegen gut: Weil das Sortiment ja tatsächlich ausschließlich pflanzenbasiert ist.
![]()
Die eigentliche Kunst besteht aber darin, jene Kunden nicht zu vergraulen, die eigentlich ganz gerne weiter Hühnchen in ihrem Mittagssalat aus dem Laden tragen würden und sich an den Schinken auf ihrem Sandwich freuen. Die komplette Pret-Kommunikation ist darauf ausgelegt, Fleischesser einzubeziehen, indem sie betont, dass die neuen pflanzenbasierten Snacks als Ergänzung zum bisherigen Angebot auch für sie gemacht sind:
„Not just für Veggies“
(Das geht auch gar nicht anders: Aus der Marktforschung weiß Pret z.B., dass 52 Prozent der Veggie-Pret-Kunden sonst sehr wohl Fleisch essen, aber ihren Fleischkonsum einschränken wollen.)
Dass mit Clive Schlee der CEO des Unternehmens selbst diese Änderungen kommuniziert und erklärt, ist dabei sicher kein Nachteil.
Aber klar: Wenn man sich als Supermarkt erst einmal daran gewöhnt hat, anonyme Pressemitteilungen mit Marketing-Geschwurbel rauszufeuern, und ein paar harmlosen Food-Bloggern mit ihrer Rezeptvermelderei den Rest der Kommunikation zu überlassen, lässt das der Chefetage natürlich deutlich mehr Freiraum, um wichtigtuerische Branchen-Interviews zu geben.
3. Kein Snack ist für die Ewigkeit
45 neue Produkte auf einen Streich hat Pret A Manger anlässlich der Eröffnung der zweiten Veggie-Filiale in London vor ein paar Wochen ins Regal geholt. Nein, das ist kein Schreibfehler. Sondern bloß die konsequente Umsetzung der Erkenntnis, dass man so viele Läden an der richtigen Stelle aufmachen kann, wie man will – aber am Ende auch ein passendes Angebot dafür braucht. Um Snacks anzubieten, die sonst niemand hat. Und Kunden, die bislang überhaupt nicht an Fleischverzicht gedacht haben, mit leckeren Zutaten und ungewöhnlichen Rezepten zu locken.
(Nein, liebe Discounter, damit ist nicht die hundertste Kartoffelsalatvariante im Mayomeer gemeint.)
Pret versucht’s zum Beispiel mit: Gemüse-Maccaroni („Mac and Greens“), getoasteten Banane-Blaubeer-Mandelbutter-Wraps, Smoothie-Frühstücks-Bowls, Boxen mit Süßkartoffel-Falafel und Gemüse sowie scharfen Joghurts mit Edamame und Spinat. Die Beststeller kommen auch in die regulären Filialen; andere Neusnacks gibt’s vorerst exklusiv in den Veggie-Läden. Das sorgt dafür, dass neugierige Kunden wiederkommen. Und hält gleichzeitig das Risiko für Flops gering.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Sortiments, im Zweifel auch auf Kosten etablierter Klassiker wie Sandwiches, hat dazu geführt, dass Pret 2016 rund 18 Prozent seines Umsatzes mit Produkten machte, die im selben Jahr zum ersten Mal ins Regal kamen.
4. Snacks für jede Tageszeit
Der Draußenesser lebt nicht vom Lunch allein, manchmal muss auch ein Draußenfrühstück sein: Deutsche Bäckerkunden wissen das schon lange und setzen diese Erkenntnis konsequent um (siehe Supermarktblog). Pret A Manger hat festgestellt, wie sich die Verkäufe seiner Snacks mit der Zeit verschoben haben: 59 Prozent der Umsätze werden gar nicht mehr zur Mittagszeit gemacht, auf die über viele Jahre das komplette Angebot ausgerichtet wurde.
Inzwischen gibt es deshalb Kokosnuss-Porridge und Frühstücks-Brioches für Kunden, die morgens unverfrühstückt das Haus verlassen haben; und wer will, kriegt auch schon vor der Lunch Hour ein glutenfreies Süppchen.
![]()
Das heißt nicht, dass frühstücksgeeignete Snacks mittags aus dem Angebot fliegen müssen. (McDonald’s hat im vergangenen Jahr massiv zulegen können, nachdem in den USA das Frühstücksangebot den kompletten Tag über verfügbar gemacht wurde.) Es bedeutet aber, dass Sofortessen-Anbieter und Supermärkte Snacks für jede Tageszeit parat haben sollten, um sich nicht unnötig einzuschränken.
Nach Köln, Berlin oder München hat sich Pret A Manger bislang nicht getraut – womöglich auch, weil die Sandwich-Kultur hierzulande eher eine Semmel-und-Schrippen-Kultur ist, die von unzähligen Bäckern und Backketten bedient wird (siehe Supermarktblog). Das dürfte vorerst auch so bleiben.
Dennoch gibt es zahlreiche Anbieter, die das Pret-Prinzip begriffen haben und (langsam) in deutsche Städte transportieren.
Prets deutsche Snack-Verwandtschaft:
Dean & David schmückt sich mit dem Motto „Fresh to eat“ und verspricht „natürliche Zutaten“, „100% frisch mit Liebe handgemacht“. An großen deutschen Bahnhöfen bietet das Franchise-System Scoom frische Sandwiches und Salate für Eilige zum Direktmitnehmen. Und der Supermarkt-Belieferer Natsu hat sich vom Sushi-Spezialisten zum Universal-Auskenner für frische Snacks gewandelt und produziert z.B. für Rewes „To Go“-Produktsortiment (siehe Supermarktblog) Sandwiches und Salate.
Den größten Umsatzschub haben in den vergangenen Jahren allerdings die ehemaligen Discount-Backketten Backwerk und Back Factory erfahren, die intensiv daran arbeiten, zu Snack-Ketten mit ansehnlichem Sortiment und schicken Läden zu werden (siehe dazu auch Supermarktblog).
Die Supermärkte sehen da noch weitgehend tatenlos zu. Und lassen sich einen Markt entgehen, der in Zukunft immer wichtiger werden könnte, um mobile und junge Kunden zu erreichen. Genug abzuschauen gibt es bei Pret A Manger auch jetzt schon. Und sei es nur: einen munter bloggenden Geschäftsführer.
![]()
Fotos: Supermarktblog!["]()
Mehr zum Thema:
Blog-Newsletter abonnieren? Hier geht’s zur Anmeldung!
![]()